Modelle des Z1-Additionszyklus
Einführung
Die Modelle des Z1-Additionszyklus machen die grundlegende Arbeitsweise des
rein mechanisch arbeitenden Zuse-Rechners Z1 sichtbar und erfahrbar. Die hier
präsentierten virtuellen Modelle basieren auf dem im Hünfelder Zuse-Museum
bereits vorhandenen realen Z1-Addierermodell.
Die Schaltelemente sind nun zu einem Kreislauf geschlossen, so dass sich das Ergebnis einer Addition auf einen der Eingänge zurück übertragen lässt. Dadurch wird die Berechnung einer Summe mit mehreren Summanden, beispielsweise a + b + c, durch rein mechanische Übertragung des Zwischenergebnisses a + b auf einen der Eingänge und Eingabe des c auf den anderen Eingang mit einer anschießenden weiteren Addition möglich.
Beim vorhandenen
Z1-Addierermodell müssen nach einer Berechnung und vor der Eingabe der neuen
Eingangsgrößen die Takte III, II und I in genau dieser Reihenfolge
zurückgesetzt werden. Dadurch gehen die Ergebnisse verloren. Eine „automatische“
fortlaufende Berechnung von mehrgliedrigen Summen ist mit dieser Schaltung
nicht möglich.
Das Zurückziehen des Taktblechs darf nicht gleichzeitig zum Zurücksetzen des Ergebniswertes führen. Das bewegte Blech, das zurzeit sowohl Ausgangsblech als auch Eingangsblech der Folgeschaltung ist, wird aufgeschnitten. Das Eingangsblech folgt dem Ausgangsblech bei der positiven Taktbewegung, nicht aber, wenn dieses zurückgezogen wird. Das Eingangsblech der Folgeschaltung bleibt in der erreichten Position, bis die Arbeit der Folgeschaltung abgeschlossen ist. Mit dem übernächsten Takt wird das Eingangsblech wieder zurückgesetzt.
Das folgende Übersichtsbild zeigt die Struktur des Z1-Additionszyklus. Die Richtungszuweisungen zu den aktiven Taktphasen ermöglichen es, mit Takt III die vom Takt I gesetzten Eingangsbleche zurückzusetzen. Umgekehrt werden die durch Takt III gesetzten Eingangsbleche durch Takt I zurückgesetzt. Analoges gilt für die Paarung II/IV.
Jede Schaltgruppe wird genauso bezeichnet wie der Takt, der diese Gruppe treibt. Anders als im Z1-Addierermodell sind die Eingangsgrößen der Schaltgruppe I von links nach rechts gerichtet. Eine weitere Änderung betrifft die Änderung der Schaltrichtung der Schaltgruppe III. Sie ist nach oben orientiert. Die Ausgänge der Schaltgruppe III setzen die Eingänge der neu eingeführten Schaltgruppe IV, die aus zwei AND-Gliedern besteht. Diese übertragen im Bedarfsfall den Ergebniswerts auf den Eingang der Schaltung.
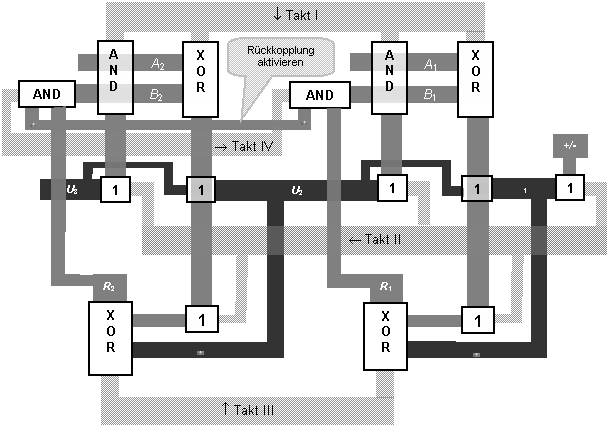
Diese Organisation ermöglicht impulsförmige Takte und eine Impulsfolge, wie sie im folgenden Diagramm zu sehen sind.
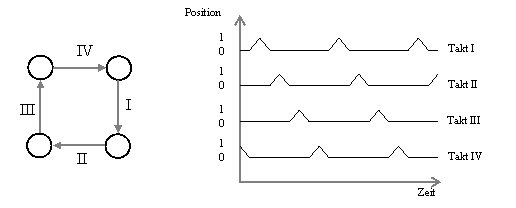
Virtuelles Modell „Jena“
Max Beese, Christian Oelke
Betreuung: Prof. Dr. Michael Fothe, Universität Jena
Das virtuelle Modell besteht aus einer Übersichtsdarstellung und Detaildarstellungen mit Explosionsbildern.
In der Übersichtsdarstellung sind die Schaltglieder nur als Rechtecke mit Funktionsbezeichnern dargestellt. Neben der Schaltungsstruktur enthält die Übersichtsdarstellung auch die Eingabefelder und Buttons zur Steuerung der Simulation. Zu Beginn sind zwei 2-Bit-Zahlen einzugeben, die erste in die Felder A2 und A1 und die zweite in die Felder B2 und B1; erlaubt sind nur die Werte 0 und 1. Nachdem die Felder befüllt worden sind, kann man mittels Checkbox wählen, ob die Zahlen addiert oder subtrahiert werden sollen.
Mit einem Klick auf „Werte einlesen“ werden die Werte gesetzt und überprüft. Die zur Eingabe gehörenden Bleche der Übersichtsschaltung bewegen sich dementsprechend. Mit den Taktbuttons kann nun die Berechnung Schritt für Schritt durchlaufen werden. Die Ergebnisse jeder Berechnung werden in Feldern angezeigt, die den jeweiligen Verknüpfungsgliedern zugeordnet sind.
Ein Klick auf das Schaltgliedsymbol öffnet die Detailansicht. Die Abläufe in Übersichtsdarstellung und Detailansicht sind unabhängig voneinander.
Virtuelles
Modell „Zittau/Görlitz“
Alexander Preuß, Ralf
Zücker
Betreuung: Prof. Dr. Christian Wagenknecht, Hochschule Zittau/Görlitz
Beratung: Andreas Samuel, Zuseum Bautzen
Hier wird die Taktung in die Schaltungsebene verlagert. Sie wird so für den Anwender vollständig sichtbar. (Falls das nicht zufriedenstellend funktioniert, kann es am Browser liegen. Versuchen Sie es mit Firefox.)
Das Modell besitzt drei Funktionsmodi. Im automatischen Loopmodus (Demonstrationsmodus) werden automatisch Eingabezahlen gesetzt und das Modell führt die Berechnung im Kreislauf endlos fort. Der Loopmodus kann per Button gestartet werden; er beginnt nach einer Zeit der Inaktivität aber auch von selbst. Gestoppt werden kann er ebenfalls über einen Button.
Im zweiten Modus, dem Automatikmodus, werden die vom Nutzer vorgegebenen Zahlen und Rechenoperation eingelesen und es folgt ein kompletter Rechenzyklus.
Der dritte Funktionsmodus ist der freie Modus. Hier kann der Anwender selbst die Rechenoperation und Eingabewerte festlegen. Auch das Auslösen der Takte geschieht durch den Anwender, entweder durch Klick auf Darstellungselemente oder auf entsprechende Buttons im Steuerfeld.
In allen drei Modi werden im Steuerfeld die Zwischenergebnisse der Berechnung angezeigt.
Für die Schaltglieder (AND, XOR, 1) gibt es Detailansichtfenster, die bei Klick auf das entsprechende Symbol des Steuerfelds erscheinen. Sie liefern dem Anwender weitere Informationen über die Schaltglieder. Dazu ist das Bauteil selbst grafisch dargestellt und alle Bleche des Bauteils können durch Klicken verschoben werden. Das Fenster enthält vier Buttons. Einer davon schaltet die Explosivdarstellung ein und aus. Die drei anderen Buttons sind jeweils Blechen derselben Farbe zugeordnet. Mit ihnen lassen sich diese Bleche unsichtbar und wieder sichtbar machen.
Timm Grams, Hochschule Fulda, 1. April 2016 (aktualisiert: 05.04.2016)