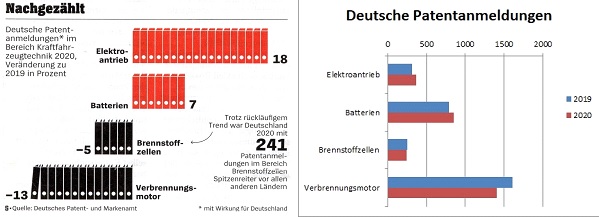Die Gedanken sind frei,
wer kann sie erraten,
sie fliegen vorbei
wie nächtliche Schatten.
Kein Mensch kann sie wissen,
kein Jäger erschießen,
es bleibet dabei:
die Gedanken sind frei.
Hoffmann von Fallersleben
Wir wollen wissen, wie es zum inneren Erleben, zur subjektiven Repräsentation der Welt kommt. Für Emil du Bois-Reymond galt dies als „Das fünfte Welträtsel“ (1880). Das habe ich in diesem Hoppla-Blog aufgegriffen und dadurch eine größere Diskussion angefacht, die auch die SciLogs-Blogs erfasst hat. Das regte mich an, diesen zweiteiligen Artikel zu verfassen, dessen erster Teil vom Erscheinen des Ich handelt. Vom Verschwinden des Ich will ich nun erzählen.
Als Metapher dient uns der Spiegel, der die Erkenntnis der Erkenntnis, dieses Ich-Erleben verdeutlichen soll, der an dieser Aufgabe jedoch kläglich scheitert. Was wir bisher gesehen haben, waren Repräsentationen; die Rückseite des Spiegels, das Wesen der Sinnesempfindungen, war nicht auszumachen. Alle Versuche, das Ziel zu erreichen, liefen auf Seitwärtsbewegungen hinaus und brachten uns dem Ziel nicht näher.
Elf Neurowissenschaftler haben dazu gesagt: „Einzelne Gehirne organisieren sich aufgrund genetischer Unterschiede und nicht reproduzierbarer Prägungsvorgänge durch Umwelteinflüsse selbst – und zwar auf sehr unterschiedliche Weise, individuellen Bedürfnissen und einem individuellen Wertesystem folgend. Das macht es generell unmöglich, durch Erfassung von Hirnaktivität auf die daraus resultierenden psychischen Vorgänge eines konkreten Individuums zu schließen.“ (Monyer, 2004)
Auch die Computersimulation gekoppelter neuronaler Netzwerke stimmt nicht optimistisch: „Selbst wenn es gelingen würde, den umfangreichen Algorithmus auf einem Computer zu implementieren, ließe sich immer noch nicht eindeutig nachweisen, ob das System wirklich bewusst ist. Es könnte kognitives Verhalten bloß sehr gut imitieren“ und weiter: „Solange unklar ist, wie man die Existenz des menschlichen Bewusstseins naturwissenschaftlich belegt, wird das bei Maschinen ebenso wenig gelingen“ (Krauß, Maier 2021).
Welträtsel Bewusstsein
In diesem und dem folgenden Kapitel zitiere ich auch aus der 757 Beiträge umfassenden Diskussion des SciLogs-Artikels Das fünfte Welträtsel: Bewusstsein. Über die Suchfunktion lassen sich Kontext und Urheber leicht ermitteln.
Auf meine Frage, ob mein Nachbar die Farbe Rot genauso empfindet wie ich, oder ob sich sein Erleben derselben Situation von dem meinen unterscheidet, kommt die Bemerkung: „Das kann man in der Tat nicht wissen. Noch weniger kann man wissen wie ein Tier, das die Farbe Rot erkennen kann, dies erlebt. Wir wissen aber auch nicht wie ein künstliches neuronales Netz, das gelernt hat, rote von blauen Bällen zu unterscheiden, diese Farben/Farbunterschiede intern repräsentiert. Unterschiedliche neuronale Netze können das unterschiedlich handhaben.“
„Ohne Materie/Energie kann Information nicht dargestellt, nicht übertragen und nicht gespeichert werden.“ Das sei „eine Widerlegung des metaphysischen Dualismus“. Dieser Auffassung schließe ich mich nicht an, denn: Metaphysik ist mathematisch-naturwissenschaftlichen Widerlegungsversuchen grundsätzlich nicht zugänglich.
„Der Körper Geist Dualismus beruht in Wirklichkeit auf der Verwechslung der Perspektiven. Spreche ich vom Körper, dann bewege ich mich im Bereich der Physik, Chemie oder Biologie. Spreche ich vom Geist, bewege ich mich im Bereich der Psychologie oder Philosophie. Ich thematisiere also zwei unterschiedliche Blickwinkel auf ein und denselben Gegenstand und meine, es wären zwei unterschiedliche Welten. Der Dualismus findet also im Kopf des Betrachters statt, nicht im Gegenstand.“ – Das kann man wohl so sehen, meine ich.
Das Ich wird gewaltsam entfernt: Daniel Dennett
Im Hauptartikel zum fünften Welträtsel schrieb ich, dass der von mir ins Auge gefasste Naturalismus für das Bewusstsein keinen Platz findet und dass die Philosophen das Problem einfach leugnen anstatt es mit einer Lösung zu versuchen.
Dem widerspricht der Naturalist mit diesem Kommentar: „Jedenfalls sind weder Gerhard Vollmer noch ich so blöd zu behaupten, unser Denken gehöre nicht zur Welt.“ Und weiter: „Als ontologische Naturalisten sagen wir vielmehr, dass Denken und Bewusstsein keine immateriellen, eigenständig existierenden Objekte sind, sondern (emergente) Eigenschaften neuronaler Systeme, die dann im Sinne eines Innenaspekts auftreten, wenn diese Systeme bestimmte hochspezifische Prozesse durchmachen.“ Weiterlesen →