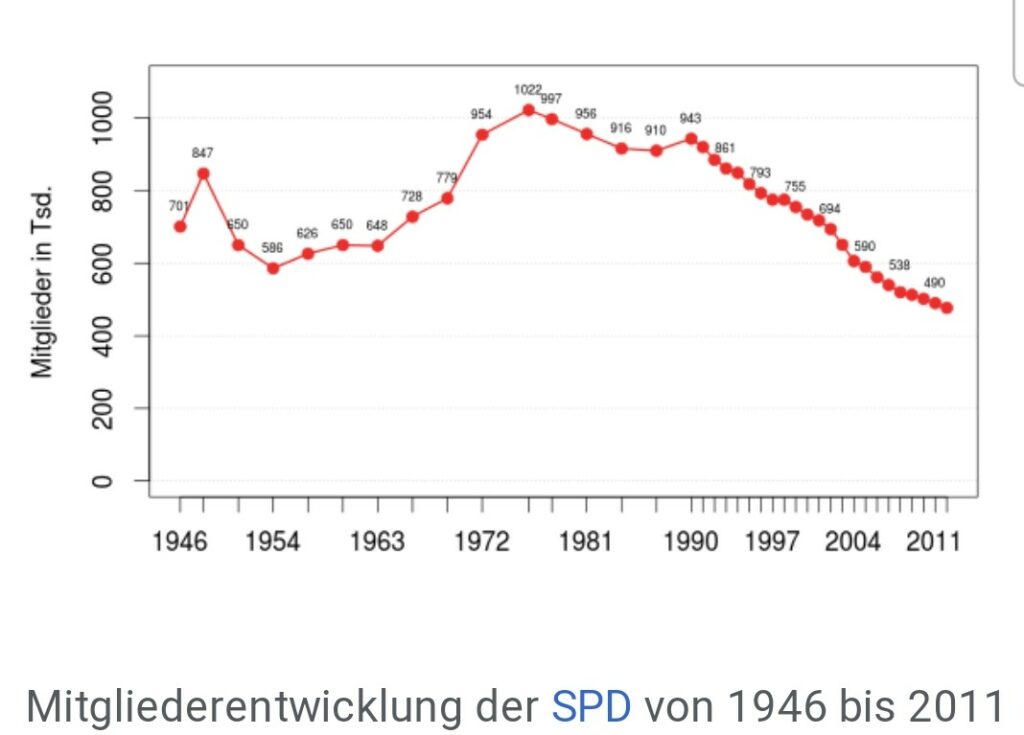Sie will einen Rock kaufen, in einem der großen Kaufhäuser Mannheims. Da hängt ein Rock, und noch ein Rock, und noch einer, und noch einer; es scheint nicht aufzuhören. Die Auswahl ist riesengroß. Wer Fulda und Schlitz gewöhnt ist, den kann hier schon der Mut verlassen. Der durch den Großstadtbetrieb konditionierte Mensch kann es vielleicht nicht verstehen: sie kapituliert und verzichtet auf den Rock.
Denken tut weh
Entscheiden in einer vielfältigen Welt ist anstrengend. Dem großstädtischen Wohlstandsbürger fällt es vielleicht nicht mehr auf, denn er ist ja trainiert und die Anforderungen gewohnt. Das Erlebnis in Mannheim führt mir aber schlagartig vor Augen, was wir uns eigentlich antun, um eine hochdrehende konkurrenzgetriebene Wirtschaft am Laufen zu halten.
Wir haben uns in der Demokratie eingerichtet und fühlen uns wohl dabei. Es erscheint unvorstellbar, dass es sich in Gesellschaften mit weniger individuellen Freiheiten glücklich leben lässt. Das üppige Konsumangebot und das ständige Wachstum haben ihren Preis, wie am verhinderten Rockkauf zu sehen ist.
Ratlosigkeit im Supermarkt: ca 10 Sorten Butter, eine eher noch größere Vielfalt beim Joghurt, von den Obstsäfte und Biersorten gar nicht erst zu reden. Wir sind auf diese scheinbare Fülle konditioniert und kommen im Alltag ganz gut damit zurecht. Aber wehe, wir weichen von der Alltagsroutine ab, dann wird es anstrengend. Will man ausnahmsweise einmal keinen Hartkäse sondern Camembert, wird die Vielfalt zur Belastung.
Wir, die wir uns in demokratischen Gesellschaften behaglich eingerichtet haben, können uns nicht vorstellen, dass es Leute gibt, die totalitäre oder autokratische Systeme bevorzugen. Die aber gibt es augenscheinlich. Ist es etwa nicht gut, wenn einem jemand Entscheidungen und die Verantwortung dafür abnimmt?
Die Rolle der Erziehung
Ich habe meine Kindheit in der DDR erlebt. Gelernt haben wir, das Gemeinschaftseigentum hoch zu schätzen. Ich fühlte mich als Miteigentümer der Straßen und Häuser und auch des Landheims. Das war ein gutes Gefühl. Ich fand es schön, in der Gemeinschaft aufgehoben zu sein.
Dann erwachte mein Eigensinn. Durch die Verwandtschaft im Westen kam der Blick auf die dort verfügbaren Güter. Das Ideal der Gemeinschaft wurde in meinem Kopf durch die mangelhafte sozialistische Praxis verdrängt. Aber in Erinnerung bleibt dennoch, dass das Gemeinschaftsdenken gegenüber dem Individualismus sehr attraktiv sein kann.
Dumme Schwärme
Denkfaulheit, Entscheidungs- und Verantwortungsscheu sind gut für Autokratien.
Im Artikel über über den Schwarm habe ich den kühnen und unbelegten Verdacht geäußert, dass auch die Schwarmbildung im Tierreich unter anderem an der „Denkfaulheit“ liegen könnte.
Wir bleiben bei den menschlichen Gesellschaften.
Buch und Film Fahrenheit 451
handeln von einer mit Hilfe von Reality Shows und Mitmachfernsehen paralysierten Gesellschaft. Die Leute hocken dämlich aber glücklich vor ihren Bildschirmen – eine Dystopie, die ich nach einigem Überlegen gar nicht mehr so schwarzseherisch fand. Ich fragte mich: Was ist denn an einer bücherlosen Welt so schlimm, wenn die Menschen vor ihren Bildschirmen glücklich sind? Nach weiterem Überlegen fand ich dann heraus, dass es doch schlimm ist. Zwischenzeitlich habe ich etwas von der Verführungskraft der Autokratie erfahren. Populismus und die identitären Bewegungen in den USA, in Frankreich bei uns in Deutschland, in der Türkei, in Polen, in Ungarn lassen sich nicht leicht abtun. Es ist eben bequem, das Denken, die Entscheidungen und die Verantwortung anderen zu überlassen.
Die Russen und die Freiheit
Ob wir wollen oder nicht: jeder von uns sieht sich gezwungen, die ungeheuerlichen Ereignisse in der Ukraine irgendwie einzuordnen. Vielleicht hat die Zustimmung des russischen Volkes zum Putinregime und zum Krieg in der Ukraine tatsächlich etwas mit Schwarmverhalten zu tun. Der Spiegel schreibt: Den Russen hat Freiheit immer Angst gemacht (Der Spiegel, 28/8.7.2023).
Im Interview sagt der Philosoph Alexander Zipko:
Die Russen haben die niedrigste Form der Selbstorganisation in Europa. Freiheit mag anziehend sein, macht aber auch Angst. Dem russischen Menschen hat sie immer Angst gemacht. In der Demokratie geht es um Wahlmöglichkeiten, um Alternativen, um den Wettbewerb von Ideen. Das Schrecklichste für einen Russen ist, nach Alternativen zu suchen.