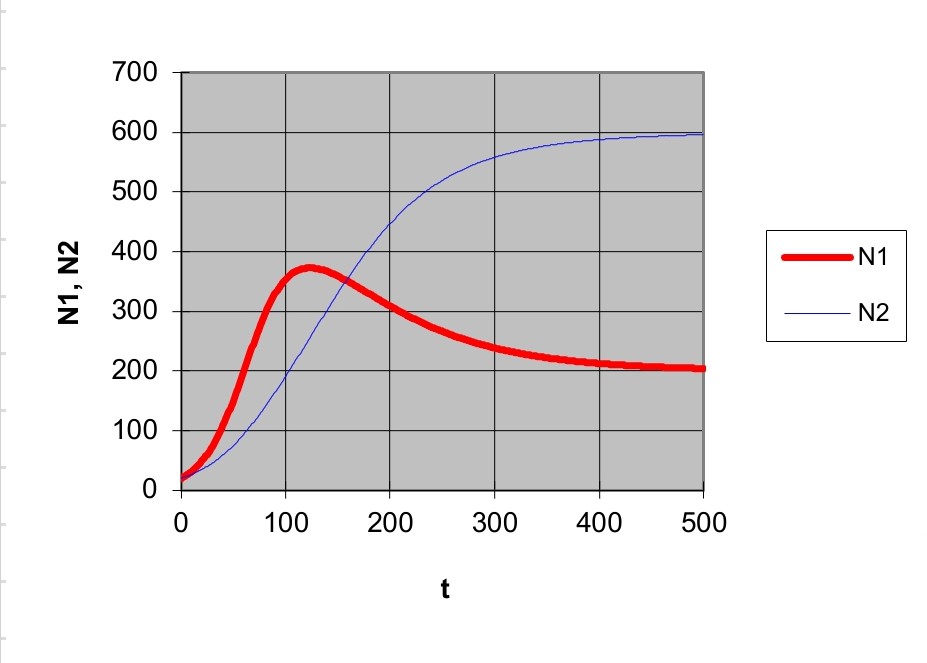Kommentar zum Artikel „Mehr Weltanschauung wagen? Waldorfpädagogik zwischen Kritik und Kurswechsel“ von Ann-Kathrin Hoffmann (skeptiker 3/2023, S. 108-114).
Wer den „skeptiker“ nicht in die Finger kriegt, dem gebe ich hier ein paar Auszüge aus dem Artikel, so dass er sich ein Bild machen kann.
Nicht nur sind diese anthroposophischen Praxisfelder [nämlich Pädagogik, Landwirtschaft, Medizin] im öffentlichen Bewusstsein heute präsenter als die dahinterstehende Epistemologie und Kosmologie, sie entfalten auch eine deutlich profanere Legitimations- und Anziehungskraft: „Sie funktionieren“, wie es von Praktikern und Konsumenten so oft heißt […]
Kurz: Man kann auch aus den falschen Gründen das Richtige tun.
Von den Eltern wählen nur rund 11% die Waldorfschule aufgrund der anthroposophischen Grundlage, etwa die Hälfte wegen des pädagogischen Konzeptes im Allgemeinen und knapp 20% schlicht aus Unzufriedenheit mit staatlichen Schulen […]
Während es bei der Debatte um anthroposophische Medizin zumeist um medizinische Fragen ging, standen in der medialen Diskussion der Waldorfpädagogik weniger die pädagogischen Ideen und Praktiken im Vordergrund als vielmehr die gesellschaftspolitische Positionierung der Schulen, ihrer Lehrkräfte und Eltern: berichtet wurde über die Kritik an Hygienemaßnahmen und ihre Nichteinhaltung über gefälscht oder ungenügende Atteste zur Befreiung von der Maskenpflicht, über Aufrufe von Eltern, Masken zu beschädigen, sowie über eine im Waldorf-Milieu verbreitete, grundsätzliche Kritik an Impfungen.
Die Sprache des Artikels ist mir fremd:
Zugespitzt lässt sich sagen, dass das Verhältnis von Individuum und Staat in den Fokus gerückt und hinsichtlich seiner politischen Implikationen thematisiert und problematisiert wurde – das Agieren dieser Akteure schien von gesamtgesellschaftlicher Relevanz.
Soviel krieg ich aber mit: Die GWUP, in deren Vereinsblatt skeptiker der Artikel erschienen ist, scheint sich von einem starren Wissenschaftsverständnis zu verabschieden, demzufolge sich beispielsweise die Homöopathie von ihrem Anfang an und allein aufgrund ihrer Begründung als Pseudowissenschaft einordnen lässt. Sie beruht nach damals vorherrschender Meinung auf Illusion und auf Annahmen, die mit der naturalistischen Ontologie nicht vereinbar sind.
Soweit ich verstanden habe, geht es heute darum, Theorie und Praxis besser auseinanderzuhalten. Eine ähnliche Bestrebung einiger GWUPler führte vor vier Jahren zu dieser Definition von Pseudowissenschaft: Als Pseudowissenschaften gelten
- metaphysische Aussagesysteme, die mit dem Anspruch der Wissenschaftlichkeit auftreten und
- Disziplinen, die bereits widerlegte wissenschaftliche Aussagen weiterhin vertreten.
(Karl Raimund Popper folgend nennen wir Aussagen metaphysisch, wenn sie grundsätzlich nicht falsifizierbar sind.)
Alice Schwarzer bietet im Spiegel-Streitgespräch vom 11. Februar 2016 eine weitere Variation dieses Themas: „Mich interessieren Motive schon lange nicht mehr. Mich interessiert nur, was jemand tut.“
Der Artikel „Neurodoron: Ein anthroposophisches Medikament “ von Edzard Ernst (S. 119-122) zeigt einen weiteren diskussionswürdigen Punkt des GWUP-Codex auf: Bei der Wirkung von Heilmitteln wird auf Evidenz viel Wert gelegt.
Nehmen wir einmal an, dass die Verbesserung der Symptome, gemessen oder subjektiv geäußert, etwas über die Wirkung eines Medikaments aussagt. Was sich vermutlich nicht so leicht klären lässt, ist, ob die Wirkung physische oder psychische Ursache hat. Wer will und kann wirklich ausschließen, dass die Trommelei und Tanzerei des Schamanen heilende Kräfte im Körper des Patienten weckt?
Wer sagt denn, dass die Weledaartikel nicht wirken, dass die Potenzierung dem, der daran glaubt, nicht hilft? Ganz falsch ist der Satz „Wer heilt, hat Recht“ meines Erachtens nicht.
Gerade die Fortschrittsapologeten und Verfechter des Wirtschaftens im westlichen Sinne lehnen solche „unrealistische“ Begründungen ab. Für mich ist das paradox, denn: Unsere wachstumsorientierte Art zu leben gründet wesentlich auf Propaganda, beschönigend Public Relations genannt.
Die Produkte werden eingekleidet in Versprechungen, was dazu führt, dass wir keine Produkte kaufen, sondern Lebensgefühl. Die Ursache-Wirkungsketten verlaufen von der Werbung über den Geist der Adressaten hin zum Markt.
Da gibt es den SUV mit über 500 PS und bis zu 280 km/h schnell. Wege, für die man ein solches Fahrzeug brauchen könnte, gibt es nicht oder man darf sie nicht befahren. Zwischen der physikalischen Wirklichkeit und dem Hochgefühl, das den Käufer beseelt, gibt’s keinen direkten Zusammenhang. Der Ursache-Wirkungszusammenhang nimmt seinen Weg über Emotionen und Unvernunft des Käufers, über den Geist also. Wir sehen: Der gewitzte Werbemann verkauft keine Autos, er verkauft Potenz.