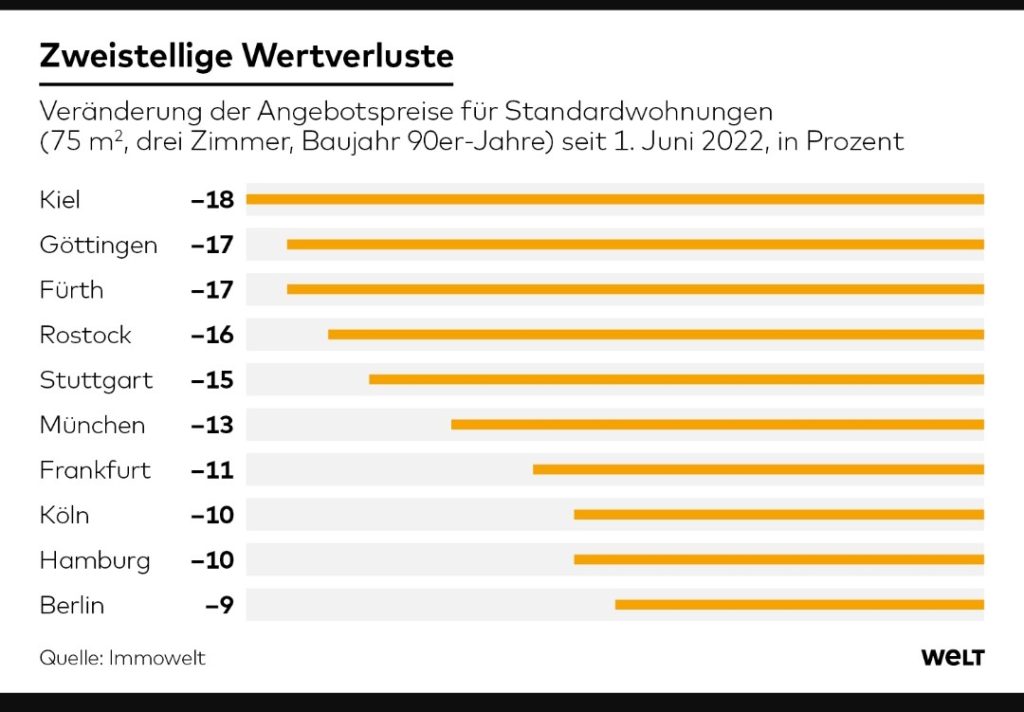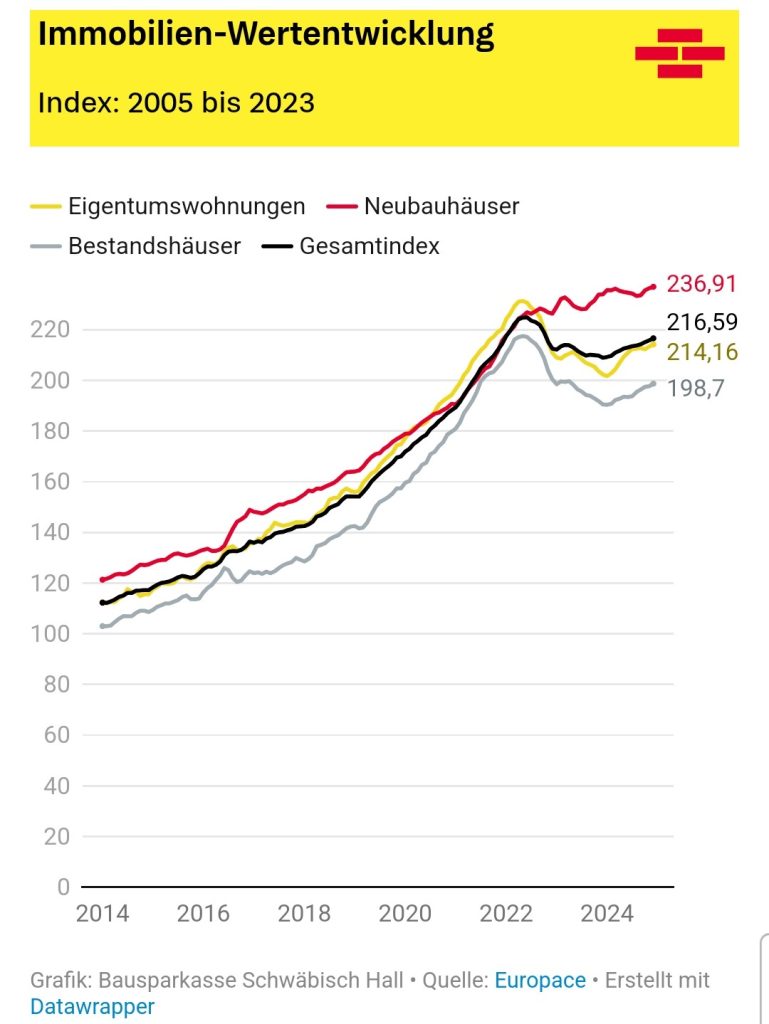Dass dieses Hoppla!-Blog Gegenstand von Verunglimpfung und Hetze sein könnte, war bis vor Kurzem für mich unvorstellbar. Eigentlich soll es ja um verpatzte Kommunikation gehen: Denkfallen, kognitive Irrtümer, Manipulationstechniken, fehlleitende Argumentationsmuster, Statistikplunder und dergleichen – Dinge, die formal abgehandelt werden können. Dazu braucht es etwas Leidenschaft für Logik und Mathematik.
Die Gefahr lauert darin, dass wir, die emotionalen Wesen, Gefahr laufen, den neutralen Beobachterstandpunkt des Skeptikers, die Metaebene sozusagen, zu verlassen. Wir beziehen Stellung.
Auf dem Schlachtfeld locken Glücksgefühle, die durch vermeintliche Überlegenheit dem Diskussionspartner gegenüber ausgelöst werden. Wut und Verachtung übernehmen das Steuer.
Um so etwas zu erleben, musste ich mich in andere Gefilde begeben, beispielsweise in das Blog von Sebastian Bartoschek. Was ich dort erlebt habe, habe ich im Artikel Der Krieg braucht Emotionen, der Frieden kühlen Kopf verarbeitet. In Bartoscheks Blog ist es mir ergangen wie all denjenigen, die angesichts des Krieges in Europa eine differenzierte Weltsicht versuchen. Selbsternannte Proponenten der Freien Welt sind schnell dabei, diese Meinungsgegner in das Kästchen mit der Aufschrift »Putintroll« zu stecken.
Auch in der Diskussion zum letzten Artikel taucht dieses Argumentationsmuster auf, zusätzlich verstärkt durch KI-generierte Textfetzen, denen die Schulung am Mainstream anzumerken ist. Das verhindert genau das, was die freie Welt so dringend braucht: Meinungsvielfalt.
Soweit sehen wir nur Unfairness. Richtig widerlich wird es erst in dem per E-Mail geführten Briefwechsel mit mir, dem Blogger. Gestern Abend gegen Mitternacht erreicht mich die Nachricht folgenden Inhalts:
Ich habe ihnen jetzt oft genug gezeigt was [xxx] da macht, Wenn Sie nix dagegen machen ist das ihr Problem, aber wenn das der falsche liest und sieht, dann wette ich knallt es. Und zwar zwischen Ihnen und der Hochschule! […] Ich mache in Minuten Analysen von kompletten Blogs wie ihrem, was meinen Sie was los ist wenn ich das in großen Stil automatisiere und der Welt bereit stelle, jeder kann dann instant prüfen was fehlt, wo wird gelogen, was wird beschönigt, wie wird rhetorisch manipuliert usw. […] Viel Spass vor Gericht, aber nicht mit mir…
Grams./.Hochschule Fulda
wg. strategischer Kommunikation von russischer Desinformation auf Hochschulserver
Ich muss sicherlich nicht erklären, warum ich das hier zum Ausdruck gebrachte Verhalten abstoßend finde.