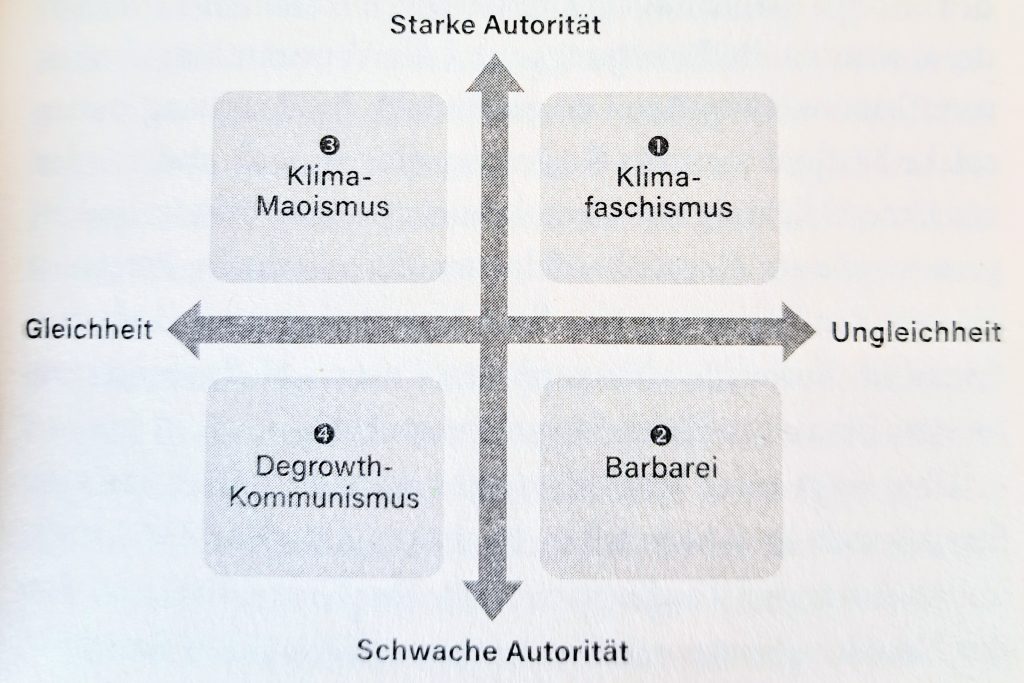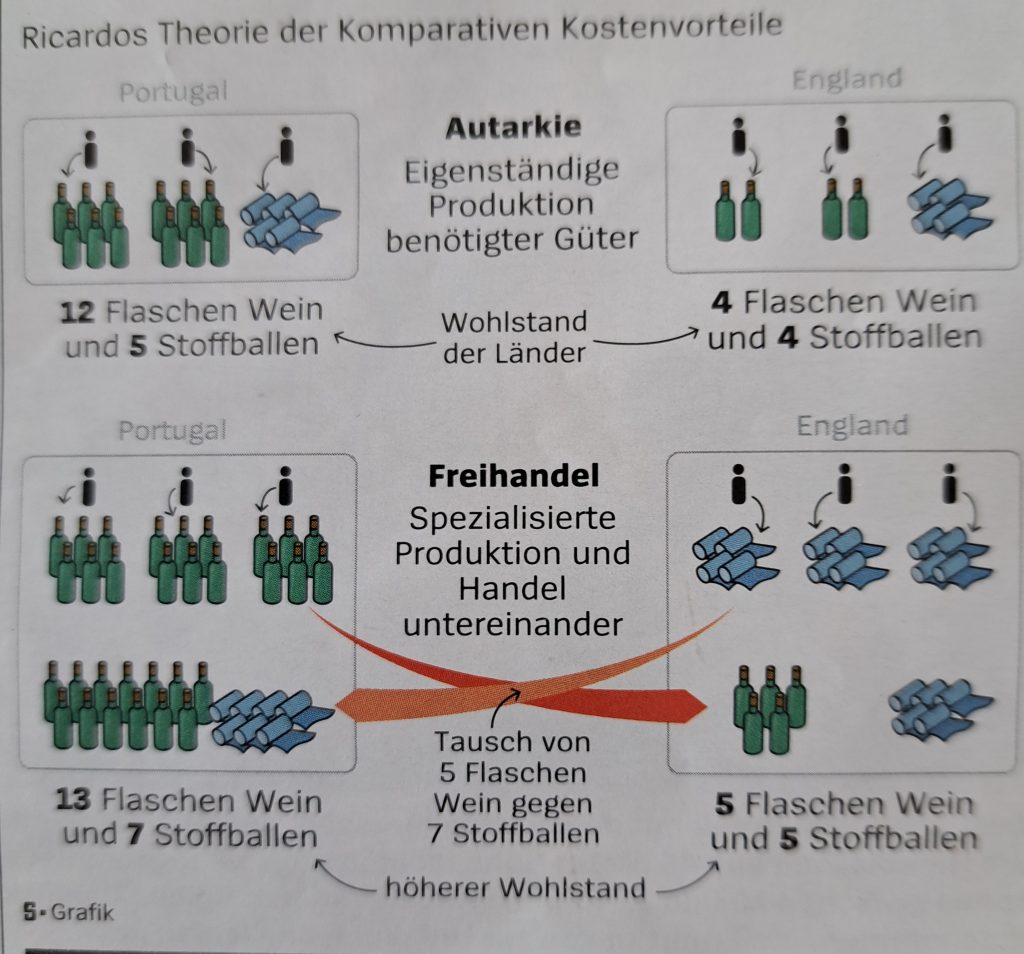Die Gier kam nicht erst mit der Moderne, mit der Industrialisierung, in die Welt. Sie war schon immer menschlich. Wohlgelitten war sie nicht. In den letzten 200 Jahren wurde sie popularisiert, auf die Spitze getrieben und letztendlich ziemlich schamlos zur Schau gestellt. Sichtbar wird das mit Larry Page, Elon Musk, Peter Thiel und weiteren kalifornischen Multimilliardären. »Die Utopie der Gier« (Ayn Rand) ist nahe.
Das Aufbrechen der Ordnung, in der ein jeder seine Platz hat und sich damit bescheidet, lässt sich grob mit der Erfindung des Buchdrucks datieren: 1451. Die Neuzeit beginnt und die Gier wird mit der »Eroberung des Paradieses« 1492 weltbewegend. Gier und Vorsehung genanntes Sendungsbewusstsein (Manifest Destiny) sind die formenden Kräfte Nordamerikas.
Gier zieht
John Locke hatte eine moderne Vorstellung davon, wie Eigentum entsteht. Eigentum wird vom Grundgesetz geschützt: Das Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet (Art 14 GG).
Man kann den Freiheitsbegriff für die grundlegende Errungenschaft der Aufklärung halten. Es ist eine starke Idee, die bei uns im Westen die Macht des Staates einschränkt und dem Schutz des Bürgers dient. Die Reichweite des Freiheitsbegriff ist auf die Verfassung eines Volkes beschränkt. Für bedeutender halte ich die materielle Basis, den Eigentumsbegriff. Eigentumsverhältnisse und -ansprüche, nicht etwa die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, bilden das Gewebe für die Beziehungen zwischen den Völkern.
Gier ist auf dem Meinungsmarkt nicht verkäuflich, Freiheit dagegen schon. Der Slogan »Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit« benennt die Ideale der Aufklärung. Wir sind gefordert, dahinter die kollektiv konstruierte Realität auszumachen.
In den Literaturhinweisen habe ich einige der mir wichtigen Bücher (und eine Fernsehserie) zum Verhältnis von Schein und Sein zusammengestellt.
Moderne
Damit kommen wir zur von Shoshana Zuboff so genannten Moderne. (Seitenzahlen in runden Klammern beziehen sich auf ihr Buch The Age of Surveillance Capitalism von 2019.) Sie schreibt, dass die erste Moderne den Zeitpunkt markiere, als sich das Leben vieler Menschen individualisierte, indem es sich von traditionellen Normen, Sinngebungen und Regeln löste (S. 33).
Arbeitsteilung, Serienfertigung und Massenproduktion machen vielen vieles erschwinglich: Autos Waschmaschinen, Kühlschränke. Neue Freiheitsräume werden sichtbar. Gier wird gesellschaftsfähig. Andererseits: Das T-Modell von Ford hat vermutlich mehr zur Emanzipation der Frauen beigetragen als irgendwelche feierlich vorgetragenen Erklärungen zur Gleichberechtigung.
Die technische Basis
Das Internet und die Suchmaschinen sind die materielle Basis dessen, was Shoshana Zuboff die zweite Moderne nennt. Von zentrale Bedeutung ist das Ranking von Suchergebnissen. Es verlangt die Bewertung der Relevanz von Informationsangeboten bezogen auf die Benutzeranfrage.
Im World Wide Web gibt es viele Milliarden Web-Seiten. Suchmaschinen wie Google sind die Navigationsgeräte in diesem riesigen Informationsangebot. Sie legen fest, in welcher Reihenfolge die Suchergebnisse in der Ergebnisliste
erscheinen.
Je weiter oben eine Seite erscheint, umso eher wird sie vom Adressaten auch tatsächlich wahrgenommen. Jeder Anbieter von Werbung ist darauf erpicht, eine möglichst gute Bewertung seiner Seiten durch die Suchmaschine zu bekommen.
Die Bewertungsverfahren sind sehr komplex. Die Suchmaschinenbetreiber tun gut daran, sie nicht im Detail bekannt zu geben. Informationsanbieter können nämlich die Eigenheiten der Berechnungsverfahren ausnutzen, um so mittels Search Engine Optimization (SEO) eine möglichst hohe Bewertung zu bekommen. Es wird also – anders als der Name sagt – nicht die Suchmaschine optimiert, sondern die Webpage.
Überwachungskapitalismus
Die Erfolgsgeschichte von Google beginnt mit dem von Larry Page
entwickelten PageRank-Algorithmus (1997), der einzig die Vernetzung der Webpages in Rechnung stellt und vom Verhalten der Nutzer und deren Vorlieben nichts wissen will.
Ziel war die Verbesserung der Suchergebnisse für den Nutzer. Geld wurde durch die Lizenzierung von Dienstleistungen an Portale wie Yahoo! verdient. Google war der Goldstandard des Gewerbes.
Nach der Jahrtausendwende kam der Richtungswechsel. Der Blick richtete sich auf das im Datenmeer verborgene Benutzerverhalten – ein Schatz, der gehoben werden wollte. Die Gier sorgte dafür, dass dies dann auch geschah, und zwar unter konsequenter Geringschätzung des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung.
Kein Grund zur Klage? Niemand wird gezwungen mitzumachen. Ja, aber die Abstinenz hat einen hohen Preis. Sie geht gegen die menschliche Natur: Erst einmal angebissen, ist der Apfel unwiderstehlich (S. 341).
Heute gibt es AdWords, das die Wünsche des Webseitenanbieters berücksichtigt und das sich gute Platzierungen bezahlen lässt (Targeted Advertising). Die Platzierung, bezogen auf Schlüsselwörter der Anfrage, wird durch eine Art Auktion festgelegt. Abgerechnet wird nach Anzahl der Klicks auf die Seite (S. 76).
Viele Klicks senken die Kosten je Klick (S. 83 ff.) . Das scheint dem Profitinteresse von Google zuwiderzulaufen. Andererseits aber soll das Google‐System Leute anziehen und bei der Stange halten; genau das gelingt mit Seiten mit hohen Klickzahlen. Deshalb wird sich ein Seitenanbieter bemühen, seine Seite besonders attraktiv zu gestalten. Das zahlt sich dann für ihn und für AdWords aus.
Und so kommt das Benutzerverhalten ins Spiel: Je besser ein Seiteninhalt zum prognostizierten Benutzerverhalten passt, umso besser wird die Seite platziert. Das sorgt für mehr Klicks und verbessert den Profit für AdWords und den Seitenanbieter.
Totalitarismus
Der Überwachungskapitalismus ist eine neue Wirtschaftsordnung, die menschliche Erfahrung als kostenlosen Rohstoff für versteckte kommerzielle Praktiken der Ausbeutung, Vorhersage und des Verkaufs beansprucht. Resultat ist eine beispiellose Konzentration von Reichtum, Wissen und Macht. Das Volk wird seiner Souveränität und wichtiger Menschenrechte beraubt.
Damit entsteht die Vorstellung eines unkorrigierbaren totalitären Staates als Träger ewiger Wahrheiten. Für Larry Page sind die totalistischen Ambitionen von Google eine logische Konsequenz des Engagements für die Perfektionierung der Gesellschaft (S. 401).
Die Idee ist in der Geschichte schon mehrfach gescheitert. Es gibt keinen Grund für die Vermutung, dass das diesmal anders sein wird.
Literaturhinweise
Phineas Taylor (PT) Barnum: The True Life of the World’s Greatest Showman. 1888
Edward Bernays: Propaganda. 1928
Gustave Le Bon: Psychologie der Massen. 1895/2009
George Orwell: 1984. 1948
Ayn Rand: Atlas Shrugged. 1957
Shoshana Zuboff: The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power. 2019
Mad Men. Fernsehserie 2007 – 2015
Weiterlesen →