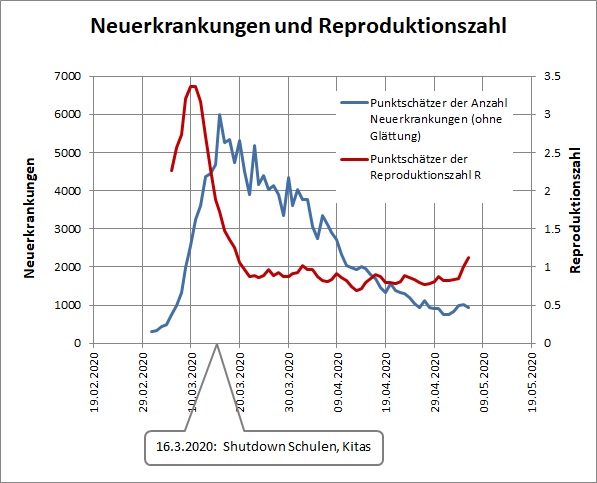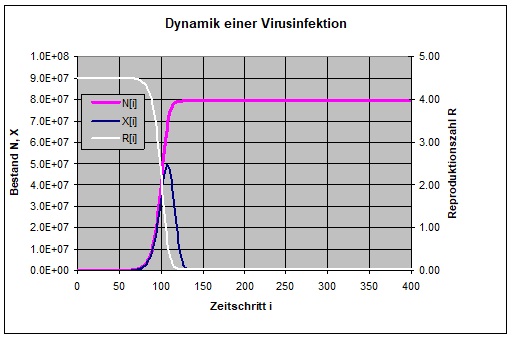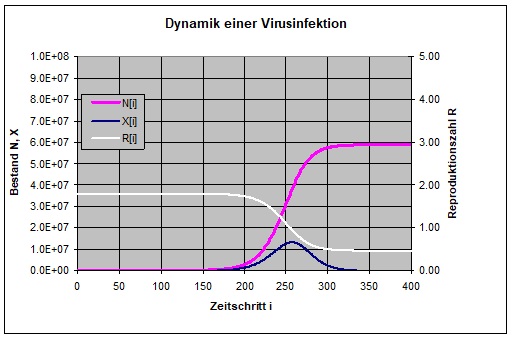Falsche Verschwörungstheorien sind Denkfallen. Früher oder später musste ich darauf stoßen. Nun hat es mich erwischt und ich sehe mich einer neuen Situation gegenüber. Die klassischen Waffen gegen Denkfallen – nachsehen, messen, rechnen, prüfen – erweisen sich gegen Verschwörungstheorien als ziemlich stumpf, denn: Verschwörungstheorien sind Phantasiegebilde auf spärlicher Faktenlage.
Wichtig ist das Wort „spärlich“. Denn nur das unterscheidet sie von den wissenschaftlichen Theorien. Aufgrund einer meist beklagenswerten Faktenlage bietet sich viel Raum für einen Haufen an Theorien; der Selektionsprozess der Wissenschaft lahmt aufgrund eines Mangels an Prüfmöglichkeiten.
Oft hilft nur noch das Sparsamkeitsprinzip weiter: Nimm die nächstliegende Erklärung, die am wenigsten spektakuläre, die mit der geringsten Zahl an nicht prüfbaren Annahmen. Wie das gehen kann, habe ich im Falle der Corona-Verschwörung gezeigt.
So etwas kann auch ins Auge gehen. Am Beispiel der Flachdachpyramide zeige ich, dass die einfachere Interpretation einer Faktenlage nicht immer die bessere ist. (Das diesbezügliche dynamische Flachdachlogo in der Kopfzeile meiner Web-Page ist zwar außer Betrieb gesetzt, da Java-Applets von den Browsern nicht mehr unterstützt werden, aber Sie können mithilfe des „Starreogramms“ sehr gut nachvollziehen, wie bei passendem Blickwinkel die Pyramide nur noch als einfacher Necker-Würfel erscheint. Die einfachere Hypothese ist falsch.)
Woran nun kann der Unvorbereitete eine Verschwörungstheorie als solche erkennen? Wie kann er sich vor falschen Verschwörungstheorien schützen? Geht es auch ohne exzessives Quellenstudium?
Ich denke: ja. Es gibt ein paar einfache Regeln, die dem Immunschutz gegen falsche Verschwörungstheorien dienen. Von ausschlaggebender Bedeutung ist das Erkennen von Warnzeichen. Wie man solche Warnzeichen findet, werde ich anhand eines einzigen Falles entwickeln, nämlich anhand des 2017 erschienenen Buches „Geheimgesellschaften 3“ von Jan van Helsing (bürgerlich: Jan Udo Holey).
Das Buch
Kurz gefasst, beinhaltet Jan van Helsings Buch Folgendes: Eine Geheimgesellschaft mit der Wurzel im Freimaurertum strebt eine Neue Weltordnung an. Zu deren „abscheulichen“ Zielen gehören die Bevölkerungsreduzierung, die Subventionierung der Abtreibung, die Förderung der Homosexualität, die Zerstörung der Familie, die Unterdrückung medizinischer Hilfen, Auslösung von Herzattacken, Verbot alter Religionen, Förderung des Drogenkonsums, Beschränkung der Bürgerrechte, Wetterkontrolle, Ersetzung der Wissenschaft durch Indoktrination, Terrorismus und vieles mehr. Kurz gesagt: Die Geheimgesellschaft strebt ein totalitäres globales System an.
Kaum ein Krimi vergisst, die Hauptfrage zu stellen, nämlich die nach dem Motiv des Täters. Die Frage Cui bono spielt im Buch aber seltsamerweise keine Rolle. Offen bleibt, was das Ganze soll. In anderen Verschwörungstheorien „sieht man klarer“: Gerade poppt im Internet die Idee auf, dass der Milliardär Bill Gates mithilfe einer Pandemie die Kontrolle über die Gesundheitssysteme der Welt erlangen und Profit daraus schlagen wolle.
Aber zurück zum Buch: Die Chemtrail-Verschwörung ist Teil der beschriebenen weltweiten Verschwörung, ebenso das, was hinter den Georgia Guidestones vermutet wird, nämlich dass das vorsätzlich entfesselte Corona-Virus dazu dient, die Weltbevölkerung zu selektieren oder zu überwachen. Und so weiter.
Michael Butter nennt so etwas Superverschwörungstheorie (2018). Eine solche entsteht durch das Verschmelzen verschiedener Verschwörungstheorien. Die Verschwörungstheorien einer solchen Kollektion dürfen durchaus zueinander im Widerspruch stehen. Vor allem über die jeweiligen Hintermänner herrscht in dem Buch völlige Konfusion. Jedenfalls haben sie mit den Freimaurern und den Illuminaten zu tun. Aber die sind ja, zwar oft verborgen, allgegenwärtig.
Das Buch gibt sich als Interview, als Zwiegespräch zwischen dem Autor Jan van Helsing und einem anonymen Freimaurer. Das Buch ist eine freie Gestaltung des Überläufer-Motivs: Überläufer genießen Vertrauen. Der Whistleblower offenbart unter Lebensgefahr sein Wissen über Vergehen seiner Organisation. Damit entsteht der Anschein der Authentizität.
Der anonyme Freimaurer spricht von einem Geheimwissen, das nur wenigen zuteil wird. Bei Geheimnisverrat droht sogar die öffentliche Hinrichtung (S. 72). Andererseits plaudert der Freimaurer durchweg von diesen Geheimnissen. Bleibt ein Überläufer ungenannt, wie hier, kann das Überläufermotiv nur den Naiven beeindrucken. Der aufmerksame Leser hingegen wird einen Schwindel dahinter vermuten.
Ich erinnere mich an den Coen-Film „Fargo“: Im Vorspann wird eine wahre Geschichte versprochen. Was folgt, ist äußerst grotesk. Im Abspann kommt der Hinweis, dass alle Personen und Ereignisse fiktional sind.
Genauso kann man das Interview verstehen: als Fiktion, als Witz. Dann hat man seinen bescheidenen Spaß daran.
Beliebigkeit der Deutungen
Sollte es den Whistleblower geben, dann ist er jedenfalls nicht ernst zu nehmen. Er verwickelt sich fortwährend in Widersprüche: Einerseits lehrt die Freimaurerei gar nichts (S.154), andererseits ist ihr Ziel die Neue Weltordnung (S. 117); alle Religionen stehen für den Freimaurer gleichberechtigt nebeneinander (S. 114), andererseits ist er gegen den Islam und für den Papst (S. 81); die Freimaurer-Logen sind eng vernetzt und verbunden (S. 66), aber es gibt einen Krieg der Logen (S. 126); die Deutschen werden im denkerischen Bereich die Führung übernehmen, obwohl sie absolut obrigkeitshörig und des Denkens entwöhnt sind (beides auf S. 199); einmal liegt die Steuerung des Weltgeschehens bei den Lenkern der Zentralbanken – alles Freimaurer –, ein andermal sind es wir alle, die über das weltumspannende morphogenetische Feld zu Steuermännern, zu Entscheidern über Krieg und Frieden werden (beides auf S. 152).
Das Buch bietet einen bunten Strauß an Verschwörungstheorien. Beim Ausleuchten der Hintergründe wird es konfus. Hinter allem stecke ein Kreis von Mächtigen, heißt es. Manche dieser Mächtigen werden benannt, wie Barack Obama, der Papst, Helmut Kohl, Angela Merkel – da hätte man auch selber drauf kommen können. Fragt der Interviewer Jan van Helsing, wer denn nun eigentlich die Kontrolle ausübt, lautet die Antwort des anonymen Freimaurers: „Ich nenne keine Namen.“ (S. 129)
Das Vage und das Chaos scheinen zum System zu gehören.
Den Verschwörungstheoretiker schreckt es nicht. Er weiß, dass der Gläubige im Chaos immer genau das sieht, was er sehen will. Anders der an Aufklärung interessierte Skeptiker. Für ihn ist das Chaos ein erstes Warnzeichen: Es zeugt von der Beliebigkeit und der fehlenden Erklärungskraft der Verschwörungstheorien.
Sackgassen des Denkens
Weiteres Merkmal von Verschwörungstheorien ist ihre Begründung im Denken der Antike. Als Fuldaer Bürger hat man einen Zugang zu dieser Denkwelt. Athanasius Kircher lehrte hier. Von ihm und von seinem Begriff der Weltharmonie war bereits die Rede, auch vom Analogiegesetz als Schlüssel für das Weltverständnis: Wie oben so unten – der Mikrokosmos als Spiegelbild des Makrokosmos.
Von noch größerer Bedeutung ist Hrabanus Maurus. Er lehrte in Fulda und war von 822 bis 842 Abt des hiesigen Klosters. Am Pfaffenpfad vom Kloster (Dom) hinauf zum Petersberg gibt es eine Tafel mit Erläuterungen zu einem seiner Figurengedichte, das „in besonderer Weise die innige Verbindung zwischen natürlichem und himmlischem Weltlauf“ verkörpert. Sein Titel: „Über die vier Elemente, die Reihenfolge der Jahreszeiten, die vier Erdteile, die vier Teile des natürlichen Tages und wie sie ihren Platz im Kreuz finden und durch das Kreuz geheiligt werden“.
Auf dieses antike Denken berufen sich heutzutage die Esoteriker. Ihre Grundsätze sind dem Corpus Hermeticus entlehnt, einem Kompendium dieses Denkens (Ehmer, 2016). Im Freundeskreis werde ich immer wieder einmal mit Feststellungen aus dieser Denkwelt konfrontiert:
- Alles hat eine Ursache
- Zufall gibt es nicht
- Alles ist miteinander verbunden
- Wie oben, so unten
Ursachen haben selbst wiederum Ursachen. Damit die Ursachensuche nicht zu einem unendlichen Regress führt, beendet der Esoteriker die Suche, indem er sich, Hermes Trismegistos folgend, auf eine welt-immanente mystische „Kraft eines ruhenden Dinges“ beruft, auf einen unbewegten Beweger also, von dem bereits Aristoteles sprach.
Dieses Ideengut hat die „alten Griechen“ nicht allzu weit gebracht, es führt in Sackgassen des Denkens. Es erwachte in der Renaissance aufs Neue, und damals wurde es auch weitgehend überwunden. Es entstand das, was wir heute Wissenschaft nennen.
Auch heute noch gibt es das hermetische Denken; es wird von den Esoterikern aller Schattierungen gepflegt. In diesen toten Winkeln des Denkens finden wir das Intelligent Design, die morphogenetischen Felder des Rupert Sheldrake und auch Hans-Peter Dürrs Weltbewusstsein. Diese Theorien erklären alles – und genau darum rein gar nichts.
Dem Jan van Helsing haben es offenbar die morphogenetischen Felder angetan. Und genau diese Bezugnahme auf die Hermetik ist für mich das zweite Warnzeichen einer falschen Verschwörungstheorie.
Kontiguität – Korrelation – Kausalität
Unsere Neigung, in allem Möglichen einen Sinn zu suchen und zu finden, zeigt sich, wenn wir in den Zufallsmustern von Badezimmerkacheln Gesichter erkennen, oder wenn sich das Wolkenbild zu einem Hund zu formen scheint. Vom erzählerischen Chaos, das in unserem Kopf zu einer Verschwörungstheorien wird, war bereits die Rede. Aber nicht nur das Chaos hat etwas zu bieten. Manche sinnstiftende und dabei völlig sinnfreie Konfiguration wird vom Verschwörungstheoretiker vorsätzlich erzeugt.
Die zeitliche oder räumliche Nähe zweier Gegenstände oder Gedanken empfinden wir bereits als Zusammenhang oder Korrelation. Und dieser Zusammenhang reichern wir dann gern mit noch mehr Sinn an und interpretieren ihn im Sinne einer Kausalität.
Diesen Mechanismus nutzt das Buch. Beispielsweise steht da: “Das Ziel [der Mächtigen] ist es, die Menschenmehrheit, eine Volksmehrheit ruhig zu halten, so wie die heutige Jugend“. Anschließend steht: „Die junge Generation unserer Zeit hat keine Zukunftsperspektive, und die Jugendlichen verfallen in Depression. Dennoch verhalten sie sich ruhig, weil sie durch Drogen und irgendwelche Spielprogramme an ihren Bildschirmen beschäftigt sind.“ (S. 87f.) Es steht zwar nicht so da, aber wer nicht aufpasst, hat schon den Schluss vollzogen: Die Mächtigen versetzen die Jugendlichen vorsätzlich in den Cyberspace, in eine Welt, die eigentlich keine ist.
Also Achtung: Das dritte Warnzeichen zeigt sich, wenn zwei Gedankengänge einfach nebeneinandergestellt werden und wenn der Autor offenbar darauf vertraut, dass wir die „richtigen Zusammenhänge“ schon herstellen werden.
Es gibt weitere Möglichkeiten, Zusammenhänge zu insinuieren und sich dabei jeglicher Haftung für die Schlussfolgerungen zu entziehen. Gern genommen wird die Frageform: „Man wird ja noch einmal fragen dürfen.“ Auch die Möglichkeitsform ist sehr beliebt: „Es könnte ja sein, dass …“ Die Verlautbarung, dass die Vereinigten Staaten über eine „Erdbebenwaffe“ verfügen und dass diese auch schon eingesetzt worden sei, wird folgendermaßen in den Bereich des Möglichen gerückt: „Wir können es zwar nicht beweisen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass so etwas schon vorgekommen ist, ist sehr groß.“ (S. 193)
Zum Schluss
Sie fragen sich jetzt vielleicht, warum ich mir antue, ein solches Schrottwerk zu studieren, wo doch ein kurzer Blick ins Internet zeigt, dass Jan van Helsing als rechtsextremistischer Esoteriker bekannt ist und dass er auch vom Verfassungsschutz so gesehen wird und dass einige seiner Bücher auf dem Index jugendgefährdender Schriften stehen.
Obwohl ich das alles weiß, spielt es bei meinen Überlegungen keine Rolle. Dem Verschwörungstheoretiker fällt es nämlich leicht, diese Urteile als Verunglimpfung anzusehen, die von den Verschwörern selbst in die Welt gesetzt worden sind.
Ein jeder von uns muss sich schon selbst an den eigenen Haaren aus dem Sumpf ziehen.
Quellen
Butter, Michael: Nichts ist, wie es scheint. Über Verschwörungstheorien. 2018
Dürr, Hans-Peter: Geist, Kosmos und Physik. Gedanken über die Einheit des Lebens. 2011
Ehmer, Manfred: Das Corpus Hermeticum. Weisheit, die aus dem Ewigen fließt. 2016
Helsing, Jan van: Geheimgesellschaften 3. Krieg der Freimaurer. Ein Hochgradfreimaurer packt aus. 2017
Oepen, Irmgard; Federspiel, Krista; Sarma, Amardeo; Windeler, Jürgen (Hrsg.): Lexikon der Parawissenschaften. 1999