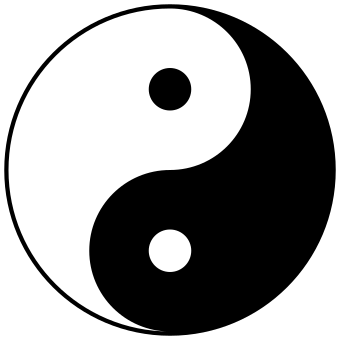Die Skeptikerbewegung in Deutschland, namentlich die GWUP, befindet sich in einer Zerreißprobe, deren öffentlicher Widerhall unüberhörbar ist.
Bisher hat sich die Skeptikerbewegung in der öffentlichen Wahrnehmung vor allem mit platten praktischen Dingen wie Homöopathie und Astrologie zur Schulung des kritischen Denkens und mit Verbraucheraufklärung befasst – weniger mit theoretischen Tiefenbohrungen.
Intern aber gab es eine Tiefenbohrung. Diese trat unter der Namen Ontologischer Naturalismus auf. Das führte nach 15 Jahren Mitgliedschaft und siebenjähriger Auseinandersetzung damit zu meinem Austritt aus der GWUP. Dieser Satz von Oscar Wilde fällt mir dazu ein: Those who go beneath the surface, do so at their peril. (Wer sich die Details antun will, der wird im Hoppla!-Blog unter dem Stichwort »Skeptikerbewegung« fündig.)
Der intern spürbare Fanatismus hat mich abgestoßen. Es ist kein Wunder, dass Fanatiker der einen Sorte die einer anderen anziehen. Wer den aktuellen Zwist verstehen will, der muss mehr als ein halbes Jahrhundert zurückgehen, in eine Zeit also, in der es die GWUP noch nicht gab.
Kritisches irgendwas
Gegenpole sind auf der einen Seite die Kritische Theorie, die ein Denksystem oder eine Gesellschaft von innen heraus analysiert und kritisiert und andererseits der Kritische Rationalismus, der versucht, einer vom Denken unabhängigen Realität mit Hilfe von Mathematik und Logik beizukommen. Die Auseinandersetzung zwischen diesen beiden Denkrichtungen in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts ist als Positivismusstreit in die Annalen eingegangen. Exponenten und prägende Figuren in diesem Streit waren auf Seite der Kritischen Theorie Theodor W. Adorno und auf Seite des Kritischen Rationalismus Karl R. Popper.
Kurz gesagt: Für den einen ist der Denkrahmen vorgegeben durch den zu untersuchenden Bereich und für den anderen ist er unabhängig davon. Das sind die jeweiligen Prämissen.
Als Beleg für diese Differenzierung zitiere ich aus Adornos Einleitung zu Der Positivismusstreit in der deutschen Soziologie (1969, 1989, S. 10):
Zu fragen wäre, ob eine bündige Disjunktion gilt zwischen der Erkenntnis und dem realen Lebensprozeß; ob nicht vielmehr die Erkenntnis zu jenem vermittelt sei, ja ob nicht ihre eigene Autonomie, durch welche sie gegenüber ihrer Genese sich produktiv verselbstständigt und objektiviert hat, ihrerseits aus ihrer gesellschaftlichen Funktion sich herleite; ob sie nicht einen Immanenzusammenhang bildet und gleichwohl ihrer Konstitution als solcher nach in einem sie umgreifenden Feld angesiedelt ist, das auch in ihr immanentes Gefüge hineinwirkt.
Gewitterwolken ziehen auf
Aufmerksam geworden bin ich auf den sich entwickelnden Konflikt durch einen Aufsatz von Martin Mahner im skeptiker, dem Vereinsblatt der GWUP, erschienen auch als Gastbeitrag im GWUP-Blog.
Dass der Aufsatz einen GWUP-internen Krach anzeigte, dessen wurde ich erst später über Internet-Medien gewahr, nämlich als bei der Neuwahl des Vorstands auf der letzten Mitgliederversammlung am 20. Mai 2023 nicht der vom scheidenden Vorsitzenden Amardeo Sarma vorgeschlagene Rouven Schäfer gewählt wurde, sondern Holm Hümmler. Von einem Handstreich ist die Rede.
Die beiden werden offenbar verschiedenen Fraktionen zugeordnet:
- Schäfer der „alten GWUP“ (kritisch rational bis szientistisch, universell orientiert und Objektivität beanspruchend, anti-woke).
- Hümmler der „neuen GWUP“ (der Critical Theory zugeneigt, partikularistisch und relativistisch, pro-woke).
Diese Sortierung ist in einer Reihe von Videos und Podcasts klar gemacht worden:
- Rainer Rosenzweig über manipulative Taktiken bei Vorstandswahl (22.5.2023)
- Gunnar Schedel über den Putsch in der GWUP (23.5.2023)
- Cornelius Courts (26.5.2023)
- Sinan Kurtulus und Nikil Mukerji (The Boys of Reason) über die skeptische Staatskrise (18.6.2023)
- Sebastian Bartoschek spricht mit Holm Hümmler (22.11.2023)
- Sebastian Bartoschek im Gespräch mit Vertretern der Pro-woke-Fraktion (5.12.2023)
- Andreas Edmüller (3.1.2024)
- André Sebastiani spricht mit Till Randolf Amelung über Cancel Culture in der GWUP (16.1.2024)
- André Sebastiani über Cancel Culture in der GWUP (17.01.2024)
Austritte
Es häufen sich die Austritte, darunter Prominente wie Edzard Ernst (2.2.2024) und Florian Aigner (April 2024).
Ergänzung am 11.4.2024: Wie unversöhnliche es inzwischen zugeht, das zeigt ein offener Brief von Ulrich Berger, in dem er den Austritt Aigners kommentiert.
Rücktrittsforderung und Rücktritt
Offenbar können sich einige Leute, deren Herzensangelegenheit die GWUP ist, das nicht länger mit ansehen. Ulrich Berger, dem wir im Hoppla!-Blog schon begegnet sind, kündigte im Gespräch mit André Sebastiani an, Holm Hümmler auf der Mitgliederversammlung am 11. Mai 2024 zum Rücktritt aufzufordern. Dem kam Holm Hümmler zuvor, was Andreas Edmüller ziemlich gnadenlos kommentierte.
Schlussbemerkung
Die Skeptikerbewegung hatte nie etwas mit Skeptizismus zu tun. Skeptikerbewegung ist ein Widerspruch in sich. Der Skeptiker ist kein Rudeltier. Die Kontroverse pro und kontra woke ergibt sich auch aus diesem Selbstwiderspruch. Dennoch: Sollte der Verein untergehen, täte es mir leid. Ich habe durch die Auseinandersetzungen viel gelernt.